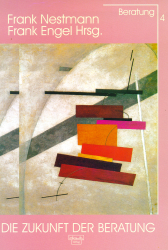
Aus unserer Reihe: Beratung
Nestmann, Frank & Frank Engel (Hrsg.)
Die Zukunft der Beratung
2002 , 340 Seiten
24.80 Euro
ISBN 3-87159-704-X
In einem rasanten Prozess der eigenständigen Profilierung und Professionalisierung von Beratung klären verschiedenste Disziplinen ihr Beratungsverständnis. Berufsgruppen und Verbände organisieren und formieren sich auf öffentlichen Märkten der Berater-Aus- und Weiterbildung und der Beratungsangebote. Mit neuen Aufgaben, Anforderungen und Klientelen verändern und entwickeln sich auch Beratungstheorien und -modelle, Beratungsbeziehungen und -methoden, Beratungssettings und -kontexte. Renommierte BeratungsforscherInnen und erfahrene BeratungspraktikerInnen präsentieren ihre Zukunftsentwürfe auf dem Hintergrund von Geschichte und Gegenwart. Sie suchen und diskutieren Maximen, Handlungsorientierungen, Spannungsfelder und interdisziplinäre Anschlussstellen einer neuen psychosozialen Beratung.
Inhalt:
Vorwort
Die Zukunft der Beratung
Frank Nestmann & Frank
Engel
Konzepte und Visionen
Beratung – Markierungspunkte für
eine Weiterentwicklung
Frank Nestmann & Frank
Engel
Identitätsarbeit als Lebenskunst – Eine Perspektive für die
psychosoziale Beratung
Heiner Keupp
Zwischen Vision(en) und
Pragmatismus – Beratung und ihre neue Qualität
Wolfgang
Schrödter
Bausteine einer zeitgemäßen Konzeption von
Beratung
Dietmar Chur
Beratung im Zeitalter ihrer technischen
Reproduzierbarkeit
Frank Engel
Beratung, von unten gesehen –
Einige Fragen und Mutmaßungen
Hans Thiersch
Macht und Beratung
– Fragen an eine Empowermentorientierung
Frank Nestmann & Ursel
Sickendiek
Gestaltung von Beratungsräumen als professionelle Kompetenz
Ruth Großmaß
Von der Vision zum Konzept – Die Schlüsselstellung
der Konzeptbildung in der Beratung
Ewald Johannes
Brunner
Subjektive Theorien, Metaphern und Geschichten
„Da
bin ich nicht mehr hingegangen“ — Warum Beratungen auf Grund diskrepanter
subjektiver Theorien von Hilfesuchenden und Professionellen scheitern
Susanne Heynen
„Ein guter Tropfen maßvoll genossen und andere
Glücksgefühle“ – Zur Metaphorik des alltäglichen Alkoholgebrauchs
Rudolf Schmitt
Die Gegenwärtigkeit der Vergangenheit — Suche
nach psychologischen Spuren der Nazizeit als Erinnerungsarbeit bei
heutigen Deutschen
Wolfgang Neumann
Beratung an der Hochschule
– ein Beratungsfeld im Wandel
Entwicklungslinien der
Studierendenberatung: Von der traditionellen Studienberatung zum
Competence-Center für (Aus-)Bildungsqualität
Dietmar
Chur
Ressourcenförderung in der Studien- und Studentenberatung –
Das Dresdner Netzwerk Studienbegleitender Hilfen
Frank
Nestmann
Migration als Stressfaktor im Studium — Überlegungen zur
interkulturellen Offenheit von Beratung
Ruth Großmaß
Frankfurter Erklärung zur Beratung
Forum Beratung in der
DGVT
Die Autorinnen und Autoren
Leseprobe:
Vorwort
Die Zukunft der Beratung
Den Autoren und Autorinnen
dieses Buches liegt eine Zukunft der Beratung am Herzen, die sich weder in
Wiederholungen von schon oft Gesagtem und Geschriebenem erschöpft, noch
ständig wechselnden Modernismen aufsitzt, die unsere Welt und damit auch
Beratung flächendeckend durchziehen. So werden zwar klient- oder
personenzentrierte Grundhaltungen oder sozialpädagogische
Lebensweltmaximen auch Beratungstheorie und Beratungspraxis der Zukunft
mitbestimmen und so mögen auch aktuell schier unausweichliche Konzepte wie
‚Coaching‘, ‚Mediation‘ oder ‚Narrationen‘ einmal Spuren hinterlassen.
Eines haben wir aber gelernt: Keine dieser Modellvorstellungen und
Handlungsentwürfe wird und kann Beratung in Gänze repräsentieren oder für
sich universelle Geltung in der Beratung beanspruchen.
Viele
Zeitgeistströmungen hat die Beratungsdiskussion und die
Beratungslandschaft über sich ergehen lassen, viele Modewellen mitgemacht
- und das wird sich nicht ändern. Lediglich die Zuversicht ist
geschwunden, dass diese Effekte überdauern. Lediglich die Sicherheit ist
gewachsen, dass diese Bedeutungen auch wieder abnehmen oder verschwinden.
Beratung verändert sich in einer sich verändernden Welt (hoffentlich!)
theoretisch, praktisch, in Bezug auf die Aufgaben, Konstellationen,
Settings, Medien und Methoden, Ziele und Zielgruppen und damit auch in
ihrem Selbstverständnis, mögen auch diese und jene Interessenten
(Disziplinen, Berufsgruppen, Verbände etc.) gerne ihre eigene Vorstellung
von Beratung als die Vorstellung von Beratung auf Dauer
festschreiben.
Die hier beteiligten Autorinnen und Autoren suchen seit
mehreren Jahren gemeinsam in offener solidarischer und auch kontroverser
Diskussion zeitangemessene und zukunftsträchtige Beratungsprofile zu
entwickeln, Schnittflächen und Kompatibilitäten ebenso wie Reibungsflächen
und Diskrepanzen ihrer unterschiedlichen Konzepte und Entwürfe
auszumachen. Sie rekonstruieren Beratungsgeschichte, analysieren
Beratungsgegenwart und fragen sich nach der Zukunft und nach Visionen von
Beratung - so auch in diesem Band.
Wenden wir uns im ersten Teil
der ‚Zukunft der Beratung‘ allgemeinen Gegenwartsanalysen und
Zukunftsentwürfen zu. Die Herausgeber beschreiben zunächst absehbare und
bereits ablaufende Entwicklungsprozesse der Beratungslandschaft.
Wohin
geht die Entwicklung der Institutionalisierung und Professionalisierung
von Beratung? Welchen Themen und Zielgruppen werden sich Berater und
Beraterinnen zuwenden? Wie werden sich unsere Theorievorstellungen von
Beratung entwickeln? Der Beitrag zeigt, dass das Wissenschafts- und
Praxisfeld Beratung allerorten und auf allen Ebenen in Bewegung geraten
ist und dass diese Entwicklungen die höchste Aufmerksamkeit und die
höchste Bereitschaft zu offensiver Mitgestaltung durch die direkten
Beteiligten - und das sind und bleiben in erster Linie Beraterlnnen und
Klientlnnen - erfordern. Frank Nestmann und Frank Engel formulieren
Markierungspunkte, die der Weiterentwicklung von Beratung in ihren
theoretischen, praktischen und professionellen Bezügen neue Impulse
verleihen sollen. Sie greifen dabei auf aktuelle Trends der
Counselling-Debatten zurück und ergänzen diese um Perspektiven einer
zukünftigen Weiterentwicklung von Beratungstheorie und
Beratungspraxis.
Heiner Keupp entwirft hierzu in ‚Identitätsarbeit
als Lebenskunst‘ eine aufschlussreiche (Sozial-)Psychologie des Menschen
in einer anforderungsreichen postmodernen Welt. Er schafft damit die
notwendige Grundlage für Entwürfe einer zeitgemäßen und zukunftsweisenden
Beratung. Beratung muss s. E. helfen, Chancen für eine innere
Lebenskohärenz zu schaffen, die heute als das zentrale Kriterium
gelingender Lebensbewältigung identifiziert wird. Von den Menschen ist
gefordert, Fähigkeiten zu Selbstorganisation, Selbsttätigkeit und
Selbsteinbettung zu entwickeln, um ein ‚ inneres‘ Ziel ‚Authentizität‘ und
ein ‚äußeres‘ Ziel ‚Anerkennung‘ zu erreichen. Beratung kann über die
Ermöglichung von Identitätsnarrationen und Identitätsarbeit, über
psychologische, soziale und materielle Ressourcenförderung sowie über die
Aktivierung und Sicherung von Partizipations- und Gestaltungsoptionen und
-fähigkeiten, aber auch über die Vermittlung von ‚positiver
Nicht-Sicherheit‘ zur Entwicklung von ‚Möglichkeitssinn‘ und ‚Selbstsorge‘
ihrer Adressaten beitragen.
• Wolfgang Schrödter geht davon aus,
dass auf Grund der zunehmenden Bedeutung von interinstitutionellen
Austausch-, Aushandlungs- und Kooperationsprozessen, die über die reine
Klienteninteraktion (im Mikrosystem Beratung) hinausgehen, heute und
zukünftig ein Kerninhalt beraterischer Professionalität sozialpolitisches
Engagement sein wird. Über eine spannende Rekonstruktion jüngerer
Beratungsgeschichte aus der Innenperspektive, in der die unvermittelte
Verbindung mit den jeweils ‚ zeitgeistigen‘ Topoi und Maximen deutlich
wird, gelingt ihm der Aufweis zentraler aktueller Entwicklungsschübe einer
durchaus in sich vielförmigen und widersprüchlichen Professionalisierung,
Institutionalisierung, Angebotsdiversifikation und Verrechtlichung.
Schrödter beschreibt sie als quasi selbstorganisierte Prozesse, die dem
Interessengemenge vieler gesellschaftlicher Gruppen und Instanzen
entspricht. Er identifiziert und belegt den paradoxen Effekt eines
tendenziellen Verschwindens des eigentlich hilfreichen Handlungsauftrags
und der beteiligten Helfer und Hilfesucher hinter Rationalitäten und
Zielen von Markt, Macht und Kontrolle in einer zu größerer ‚Reife‘
entwickelten professionellen und institutionellen
Beratungslandschaft.
• Dietmar Chur will in seiner umfassenden
Zusammenstellung von Bausteinen einer zeitgemäßen Beratung einen allgemein
orientierenden Rahmen von Beratungshandeln entwerfen, der jenseits
spezifisch disziplinärer Konzepte und jenseits spezifischer
Beratungsfelder die Funktion einer wie er es nennt ‚allgemeinen Grammatik‘
von Beratung übernehmen könnte. Er untersucht Beratung - im Schnittpunkt
der Disziplinen, Anwendungsbereiche, Methoden und Settings; - als
Förderung von Schlüsselkompetenzen (hier stellt er direkte Bezüge zu
seinem 2. Beitrag zur Studierendenberatung in diesem Band her); - als
kontextbezogenes und systemisches methodisches Handeln - welches ein
reflektiertes Auftragsmanagement voraussetzt. Seine Wahl fällt so auf vier
Bausteine, mit denen er sich seit Jahren theoretisch und praktisch befasst
und die hier erstmals in dieser ausführlichen Form integriert werden. In
einer bis zu den Ursprungskonzepten zurückführenden theoretischen
Herleitung (z. B. von Modernisierungsprozessen, Kompetenzmodellen,
Systemik etc.) und einem Zusammenspielen verschiedener teils scheinbar
inkompatibler Modellvorstellungcn (z. B. Systemik und Ressourcenökologie
etc.) gelingen hier neue Perspektiven auf Beratung, die zudem nicht im
Abstrakten belassen, sondern in aufschlussreichen Fallfassetten
exemplifiziert werden.
Frank Engel thematisiert die durch Neue
Medien hervorgerufenen Herausforderungen an die Zukunft von Beratung. Mit
einleitendem Blick auf Walter Benjamins Essay über das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit formuliert er die These,
dass auch Beratung einer zunehmend technischen Reproduzierbarkeit
unterliegt. In seiner Analyse medialer Rahmenbedingungen wird deutlich,
dass ein „Weiter so“ der Beratungsangebote und Beratungsformen eine
Sackgasse darstellt und Beratung sich diesen Anforderungen gegenüber
gestaltend öffnen und neu positionieren muss. So unterliegt auch Beratung
den Bedingungen medialer Aufmerksamkeits- und Präsenzökonomie, ihre
Anbieter müssen verstärkt Aktives Vertrauen sicherstellen und Ratsucher
werden in Zeiten, da sie zwischen realen und virtuellen Beratungswelten
pendeln können, andere Erwartungen an Beratung stellen, auf die zu
reagieren ist. Derartige Veränderungen werden aber - so sein Resümee -
Beratung nicht grundlegend verändern, sondern eher beweglicher und
fassettenreicher machen. Wir freuen uns sehr, dass Hans Thiersch uns einen
neuen Text für den Band zur Verfügung stellt, den er in einer einmaligen
für ihn so typischen Art an seine für die Beratungsdiskussion und
-entwicklung in Deutschland grundlegenden Arbeiten zu einer lebenswelt-
und alltagsorientierten (Sozialpädagogik und) Beratung anknüpft und deren
Maxime er kritisch auf die heutige Situation bezieht. In einer sensiblen
Betrachtung des beratenden Mikroverhältnisses ‚von unten‘, eingebettet in
den zeit geschichtlichen Kontext, reißt er bisher ungestellte, weil
‚unmoderne‘ Fragen auf, die unseres Erachtens doch weiterführen als ein
häufig sich wiederholendes ‚Beratungsreden‘, dem viele (wir wollen uns da
nicht ausnehmen) immer mal wieder anheim fallen. Zeit und Ruhe,
Unterprivilegierung und Armut und damit (auch noch 2002) einhergehende
Deutungs- und Sprachformen der Lebensbewältigung (in einer Gesellschaft,
die sich als ‚Kommunikations-‘ Gesellschaft bezeichnet), die subjektive
und widersprüchliche Wahrnehmung des Beratungsbedarfs und der
Beratungskonstellationen durch diejenigen, die Beratung brauchen und nötig
haben, oder die mutige Frage nach negativen Folgen von Aufklärung und der
Bedeutung ‚schützen der Lebenslügen‘ stoßen uns auf ungeklärte und
unbeforschte Gebiete der Beratung, die zukünftig zweifellos mehr
theoretische und empirische Aufmerksamkeit verdienen.
• Auch Frank
Nestmann und Ursel Sickendiek greifen eine alte Debatte um Beratung wieder
auf - die Frage der Macht und Machtungleichheit in Beratungsbeziehungen.
Eine Analyse unterschiedlicher Machtstrukturen und -dimensionen wird
verbunden mit der Frage, ob und wie Beratung Prozesse persönlichen und
sozialen Empowerments fördern kann.
• Ruth Großmaß, die Beratung
als ‚eigenständigen kulturellen Raum‘ entdeckt, widmet sich dieser bisher
weitgehend vernachlässigten und wie sie überzeugend nachweist doch so
prägenden Raumdimension auf drei Ebenen. Sensibel analysiert sie zunächst
das räumliche Beratungssetting und seine Implikationen für Klientele wie
BeraterInnen; erhellender noch ihre ganz neuen Perspektiven auf Beratung
als Ort im soziokulturellen Raum im Rückgriff auf Bourdieu und auf den
Umgang mit dem öffentlichen Raum. Die gelungene Verknüpfung theoretischer
Zugänge und praktischer Beispiele fundiert die von Ruth Großmaß gezogenen
Konsequenzen für ein neues Verständnis professioneller Beratungskompetenz
heute und in Zukunft.
• Ewald Johannes Brunner fordert zu Recht
Vorsicht und einen reflexiven Umgang mit dem auffällig populären Begriff
‚Vision‘ ein. Im Spannungsfeld zu ‚Konzept‘ diskutiert er die Rolle von
Beratungszielen für Beratungsqualität und Beratungserfolg - sei es in
personenbezogenen oder organisationsbezogenen Beratungskonstellationen und
-prozessen. Lassen wir an dieser und jener Stelle Raum für Visionen der
beteiligten Autoren und Autorinnen, bevor in Teil 2 des Bandes sich drei
Texte mit der Mikrostruktur von Beratungsprozessen befassen. Gelingen uns
neuere Blicke auf und Einblicke in die Beratungsinteraktionen und
Beratungskonstellationen, wenn wir die subjektiven Theorien, die Metaphern
und die Geschichten der Beteiligten zum Thema machen?
• Susanne
Heynen widmet sich in diesem Zusammenhang (basierend auf einer umfassenden
eigenen Studie) den subjektiven Theorien von Vergewaltigungsopfern in der
Beratung. An vielen einzelnen Dimensionen des Beratungsprozesses - von der
Ausgangssituation der Klientinnen über die Inanspruchnahme professioneller
Beratung, die Beratereinstellungen, Verhaltens- und ‚Fehlverhaltens-‘
weisen der Berater bis hin zur Reaktionen der Hilfesuchenden - arbeitet
sie die (insbesondere für die Hilfe suchenden Frauen) fatalen Folgen
diskrepanter subjektiver Theorien von Ratsuchenden und Beraterlnnen
heraus. Heynens Analyse entdeckt in diesem Zusammenhang eine Vielzahl
öffentlicher und professioneller Mythen, Haltungen und Handlungen, die
nicht helfen, auch wenn sie dies vorgeben; die zusätzlich belasten oder
gar nochmals und sekundär schädigen. Es wird deutlich, dass eine
zukünftige Beratungsforschung subjektiven Theorien der Beteiligten und
ihren Wirkungen, Kompatibilitäten und Diskrepanzen weit mehr
Aufmerksamkeit widmen muss als dies in der Vergangenheit geschehen
ist.
• Rudolf Schmitt wirft hingegen einen genaueren Blick auf die
Sprache - zentrale Kommunikationsform in Beratungsprozessen - und
sprachliche Bilder. Ihn interessieren die Bedeutungen von Metaphern und am
Beispiel einer Studie zur Metaphorik des alltäglichen Alkoholgebrauchs
verdeutlicht er, wie fatal eine Vernachlässigung metaphernanalytischer
Betrachtungen ist - insbesondere dort, wo die Metaphorik von Helfern und
Hilfesuchenden nicht zueinander passen. Direkte Konsequenzen für die
Beratung ergeben sich u. a. dort, wo ein für gelingende Beratung
grundlegendes gegenseitiges Verständnis, wo eine emotionale Vertiefung von
Erfahrungen und auch dort, wo die Integration der Leib- und
Körperdimension Ziel beraterischen Handelns sind. Metaphernsensibilität in
der Beratung ist gefordert. Wie die subjektiven Theorien verlangen auch
die metaphorischen Formen und Gehalte professioneller Beratung mehr an
theoretischer, empirischer wie auch praktisch professioneller
Aufmerksamkeit.
Wolfgang Neumann macht uns in seinem Beitrag zur ‚
Gegenwärtigkeit der Vergangenheit‘ klar, dass auch eine gelingendere
Zukunft von Beratung nicht ohne eine Reflexion des ‚Gewordenseins‘ der
Beteiligten möglich wird. Er sucht nach den psychologischen Spuren des
finstersten Kapitels deutscher Vergangenheit in Beratungsgesprächen mit
KlientInnen, die die Nazizeit und den Holocaust (nur) in den erzählten wie
den verschwiegenen Geschichten ihrer Eltern und Großeltern aufgenommen
haben. Dabei zeigt er in Fallbeispielen die psychosoziale Produktivität
einer ethnomethodologischen Strategie der Inszenierung von
Interaktionskrisen in biografisch sensiblen Beratungsprozessen.
Schließlich widmen wir uns einem ebenso wichtigen wie in Deutschland
unterschätzten Entwicklungsfeld von Beratung - der höheren Bildung und der
Hochschule -. Hier wo Beratung (auch) ihre Anfänge nahm, ihre
eigenständigste Identität entwickelte, gilt es neue Perspektiven zu
entwerfen und neue Strategien zu erproben.
In seinem zweiten
Beitrag zu diesem Band rekonstruiert Dietmar Chur zunächst die Geschichte
und den Werdegang der deutschen Studierendenberatung von den 60er Jahren
bis heute. Der Wandel der gesellschaftlichen und universitären
Anforderungs-, Aufgaben- und Funktionskontexte wie interne
Entwicklungsdynamiken machen die aufgewiesenen formalen wie inhaltlichen
Veränderungen der Beratung an der Hochschule verständlich und
nachvollziehbar. Dietmar Chur, langjähriger Mitgestalter und teilnehmender
Beobachter dieser Prozesse an einem prominenten Zentrum dieser
Entwicklungen (in Heidelberg), weist schlüssig die Verschiebung der
jeweils herrschenden Beratungsaufgaben, Beratungskonzepte und Zielgruppen
nach und lässt seine Rekonstruktion des Wegs von der traditionellen
Studienberatung hin zu einem Kompetenzzentrum für (Aus-)Bildungsqualität
in die Beschrei bung des ‚Heidelberger Modells‘ münden. In der
zukunftsträchtigen Form eines Kompetenzzentrums werden
Beratungsperspektiven auf allen Ebenen des Systems Universität
zusammengeführt, die präventiv wie bewältigungsorientiert
Schlüsselkompetenzen bei Lernenden und didaktische Kompetenzen bei
Lehrenden ebenso in ein neues Beratungsverständnis integrieren wie
Maßnahmen der Strukturentwicklung und der Qualitätssicherung sowie das
Schnittstellenmanagement zu anderen Beratungs- und Hilfeeinrichtungen der
Hochschule.
• Frank Nestmann berichtet über ein Projekt präventiver
Studien- und Studentenberatung an der TU Dresden. Angelehnt an
anglo-amerikanische Modelle der Netzwerk- und Selbsthilfeförderung an der
Universität und bezogen auf neuere Entwicklungstendenzen der
Studienberatung werden unterschiedliche Strategien ressourcenorientierter
Beratung und Intervention konzipiert und an Beispielen
konkretisiert.
Gerne haben wir den abschließenden Beitrag von Ruth
Großmaß zur Beratung von Studierenden mit Migrationshintergrund
aufgenommen, befasst er sich doch mit Problemen und Perspektiven einer
Klientel- und Nutzergruppe, die für das Feld psychosozialer Beratung
generell insbesondere aber im internationalen und inter kulturellen
Setting Hochschule bedeutsamer wird. Die Autorin beschreibt aus ihrer
praktischen Erfahrung als Studien- und Studentenberaterin die
unterschiedlichen Gruppen ‚ausländischer‘ Studierender und
‚Bildungsinländer‘ mit ihren je spezifischen strukturellen wie
persönlichen Zugängen und Zugangsbarrieren. Sie charakterisiert ihre
Stellung im Land, an der Universität und auch in der Beratung als
‚Zwischenstatus‘. Wege zu einer größeren interkulturellen Öffnung von
Beratungsangeboten, die individuelle wie für Migrationsgruppen spezifische
Bedingungen und Orientierungen reflektieren, werden entworfen.
Bevor
wir den Leser/die Leserin schließlich in die Zukunft oder besser in die
Zukünfte von Beratung entlassen, wollen wir die Leser mit der ‚Frankfurter
Erklärung‘ des Forums Beratung in der DGVT zu einem neuen Diskurs zur
Beratung aufrufen. Diskutieren Sie mit uns, wie die ‚Zukunft der Beratung‘
aussehen wird - kann - soll oder muss.
Frank Nestmann, Frank
Engel, Dresden, Bielefeld 2001 Frank Nestmann, Frank Engel Dresden,
Bielefeld 2001 Frank Nestmann, Frank Engel Dresden, Bielefeld 2001